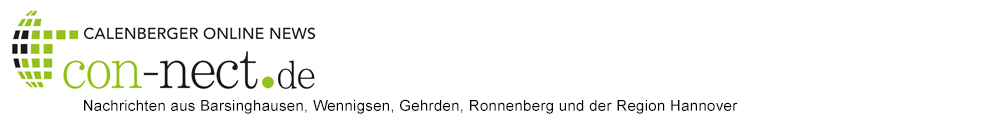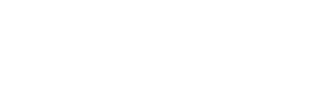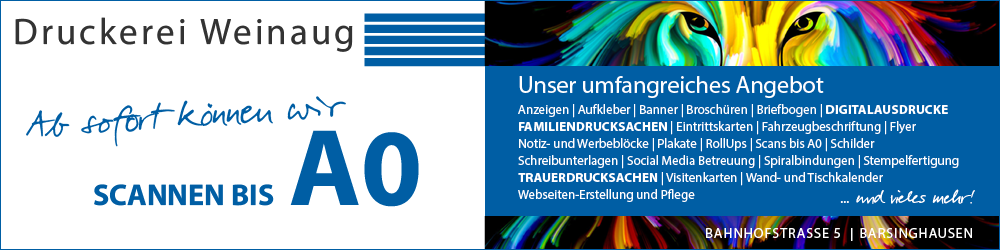Hannover. Immer mehr Haushalte erzeugen ihren Strom aus Solartechnik und speisen nicht genutzten Strom gegen Geld ins öffentliche Netz ein. Der Boom von Photovoltaik (PV) führt dazu, dass zu Spitzenzeiten das Netz überlastet ist. Das Solarspitzengesetz soll Netzüberlastungen verhindern, indem es die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung einschränkt. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen erklärt, was das für Eigentümer von Solaranlagen bedeutet.
Wer eine Photovoltaik-Anlage betreibt und überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einspeist, bekommt dafür Geld. Diese sogenannte Einspeisevergütung ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt, sie gilt ab Inbetriebnahme der Anlage für zwanzig Jahre. Das Solarspitzengesetz, das seit 25. Februar 2025 in Kraft ist, bringt eine wichtige Änderung mit sich, erklärt Andreas Holtgrave, Energieexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen: „Wer zu Spitzenzeiten Strom einspeist, bekommt dafür künftig unter Umständen kein Geld mehr. Es lohnt sich dann mehr, den selbst produzierten Strom auch selbst zu verbrauchen.“
Stromproduktion: Je mehr, desto billiger
Hintergrund: Die Zahl der PV-Anlagen in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Wenn die Sonne scheint, speisen viele Anlagen Strom ins Netz ein – mehr als benötigt. Netzüberlastung droht, und weil das Angebot größer ist als die Nachfrage, sinken an der Strombörse die Preise. „Für Abnehmer wird Strom dann billiger, und wenn sehr viel Strom gleichzeitig eingespeist wird, sind sogar negative Preise möglich“, erklärt Holtgrave.
Solarspitzengesetz soll Einspeisung begrenzen
Hier setzt das Solarspitzengesetz an: Solange die Preise an der Strombörse negativ sind, haben Betreiber von PV-Anlagen künftig keinen Anspruch mehr auf Vergütung nach EEG – das heißt, sie bekommen in dieser Zeit kein Geld für den Strom, den sie ins Netz einspeisen. Dafür bietet das Gesetz einen Ausgleich: Die zwanzigjährige Laufzeit der Einspeisevergütung verlängert sich, und zwar um die Tage, an denen keine Vergütung gezahlt wurde. Holtgrave erklärt: „Die Kalkulation des Gesetzgebers: Wenn sich das Einspeisen nicht lohnt, verbrauchen Betreiberinnen und Betreiber von PV-Anlagen ihren Strom lieber selbst oder speichern ihn für später. Dadurch wird das Netz entlastet.“
Wer ist an die Regelung gebunden?
Das Gesetz gilt für alle PV-Anlagen, die nach dem 25. Februar 2025 in Betrieb genommen wurden, und für alle Anlagen ab zwei Kilowatt Leistung. Privathaushalte mit Ein- und Zweifamilienhäusern haben typischerweise PV-Anlagen mit drei bis 20 Kilowatt Leistung (kWp) installiert. Außerdem muss ein Smart Meter installiert sein. Wer das nicht hat, darf nur maximal sechzig Prozent der Gesamtleistung einspeisen. Haushalte, die schon vor dem 25. Februar 2025 eine PV-Anlage in Betrieb hatten, können sich freiwillig für oder gegen die neuen Regelungen entscheiden. Wer auf den Vergütungsanspruch bei negativen Preisen verzichtet, bekommt dafür 0,6 Cent mehr pro eingespeister Kilowattstunde.